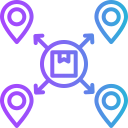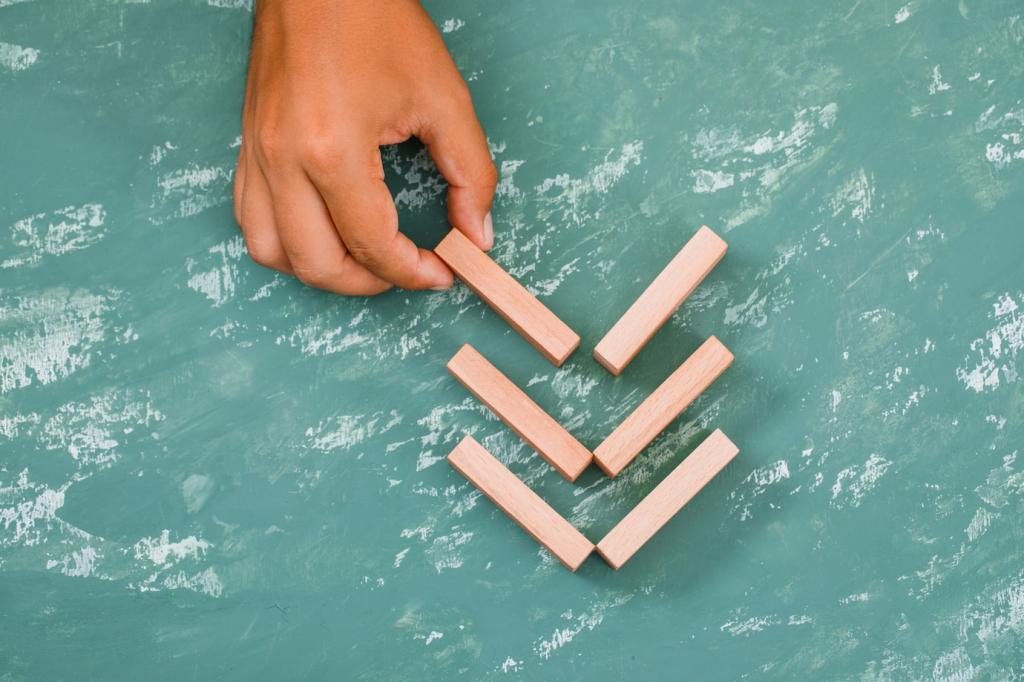Zyklusinventuren und Datenqualität
Regelmäßige, risikobasierte Zählungen halten Daten frisch und vermeiden den großen Stillstand. A-Teile häufiger, C-Teile seltener zählen schafft Fokus. Erkennen Sie Muster, berichten Sie Ursachen und laden Sie Ihr Team ein, Verbesserungen konsequent umzusetzen.
Zyklusinventuren und Datenqualität
Abweichungen sind Lernchancen. Visualisieren Sie Differenzen pro Ursache, nicht nur pro Artikel. Nur so lassen sich Diebstahl, Buchungsfehler oder Verpackungseinheiten gezielt anpacken. Teilen Sie Ihre Erkenntnisse in den Kommentaren und profitieren Sie vom Schwarmwissen.
Zyklusinventuren und Datenqualität
Einmal sauber gepflegte Stammdaten sparen täglich Arbeit. Einheitliche Einheiten, korrekte Packgrößen und gepflegte Lieferzeiten verhindern Dominoeffekte. Investieren Sie bewusst eine Stunde pro Woche und berichten Sie, welche Kennzahl danach am deutlichsten stabiler wurde.
Zyklusinventuren und Datenqualität
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.